Herzlich willkommen auf dem Erlebnisblog des JCF Team Mentale Gesundheit!

Wir freuen uns diese Geschichten anonym teilen zu können, um euch zu zeigen, dass das es Problem in der wissenschaftlichen Community gibt, mit denen ihr nicht allein seid, und wollen für mehr Akzeptanz von Erkrankungen werben. All unsere Blog-Geschichten findest du auf unserer Instagram-Seite.
Möchtest du deine Geschichte mit uns teilen? Dann fülle unser Formular aus.
Meine Masterarbeit wollte ich eigentlich im Ausland schreiben – doch dank Corona musste ich mich von diesem Plan verabschieden. Ich wandte mich also an meine Betreuer im Ausland und sie empfahlen mir eine Gruppe in Deutschland, die im selben Themengebiet arbeitete. Ich konnte mein Glück kaum fassen, als ich eine Zusage der Gruppe bekam und so schnell einen neuen Platz zu einem ähnlichen Thema für meine Masterarbeit ergatterte. Bald schon musste ich jedoch feststellen, dass der neue Platz für die Masterarbeit gar kein Glück war. Zu Beginn war der Gruppenleiter nicht vor Ort und mein betreuender Doktorand ließ mich schnell wissen, dass er selbst genug zu tun hatte, gestresst war und von der Betreuung von mir keinerlei Vorteile hatte. Direkt in den ersten Tagen fragte er mich spöttisch, ob ich denn eigentlich nicht meinte, dass das abgesteckte Projekt viel zu groß sei für eine Masterarbeit? Aber ich hätte ja nichts tun können, das Projekt war schließlich vom Gruppenleiter vorgegeben und er erwartete, dass das gesamte Projekt in meiner Masterarbeit bearbeitet wurde.
„Der ist halt manchmal so, ignorier das“
Schnell stellte sich heraus, dass die Arbeitsatmosphäre in der Gruppe alles andere als gut war. Arbeitszeiten von zehn Stunden am Tag waren für alle das absolute Minimum, das erwartet wurde. Fast alle, teilweise auch Doktoranden, mussten Wochenpläne schicken, die vom Chef abgesegnet werden mussten und dann auch vollständig einzuhalten waren – egal wie lange alles dauerte. Die ständige schlechte Laune meines Betreuers wurde als „Der ist halt manchmal so, ignorier das“ abgetan. Nachdem ich einige Male um Hilfe gebeten hatte und mehr Zeit brauchte, um Dinge zu recherchieren, als er erwartet hatte, ging er zum Gruppenleiter und erzählte diesem, ich sei nicht motiviert, wollte Dinge nicht selbst herausfinden und war ganz offensichtlich überhaupt nicht neugierig – eine Meinung, die der Gruppenleiter dann auch einfach so übernahm.
Ich war verzweifelt – ich hatte solche Probleme noch nie gehabt, war in allen Praktika gut zurechtgekommen und meine Betreuer waren immer mit mir zufrieden. Lag das alles an mir? War ich einfach zu wenig neugierig und nicht motiviert genug? Ich wandte mich an die psychosoziale Beratungsstelle meiner Uni. Die sehr nette Psychologin dort besprach alles mit mir und sagte, dass es auch kein Weltuntergang sei, die Masterarbeit abzubrechen. Auch wenn ich darüber nachdachte und die Masterarbeit schlussendlich trotzdem in der Gruppe beendete, war es unglaublich hilfreich, diesen Satz ausgesprochen zu hören.
„Ich quälte mich jeden Tag mit Bauchschmerzen an die Uni.“
In Frage kam Abbrechen trotzdem nicht für mich – ich quälte mich jeden Tag mit Bauchschmerzen an die Uni, hatte jeden Tag auf dem Weg dorthin Angst, was heute wieder passieren würde, wusste nicht mehr, welche Fragen ich noch stellen durfte ohne als unmotiviert abgestempelt zu werden. An einem Tag sagte der Gruppenleiter ganz beiläufig im Labor zu mir „Naja, vielleicht bist du dann einfach nicht für die Forschung gemacht“ – für ihn war nur Forschung an der Uni wirklich Forschung. Er verstand nicht, dass für viele eine Industriekarriere das Richtige ist und nicht jeder bereit ist, sein Leben komplett für Chemie aufzuopfern. Ich war völlig vor den Kopf geschlagen – wie sollte ich denn jemals eine Doktorarbeit schaffen, wenn das hier alles gar nichts für mich war? Wenn ich einfach nicht motiviert genug wäre? Hatte er Recht? Aber wie sollte ich denn ohne Doktorarbeit in die Industrie gelangen?
Monatelang ging das alles so vor sich, bis dann kurz vor dem Ende nochmal ein Hammer und damit vielleicht auch eine kleine Beruhigung kam. Da ich die Arbeit extern anfertigte, stand ich vor der Verteidigung wieder viel in Kontakt mit einem Professor (meinem Erstbetreuer) meiner Heimatuni, bei dem ich auch schon ein Praktikum absolviert hatte. Er wunderte sich sehr über die Formulierung des Gruppenleiters, dass ich am Tag der Verteidigung nur erfahren sollte „ob ich bestanden hatte“. Mein Erstbetreuer bat mich daraufhin um ein Telefongespräch, in dem er fragte, ob alles okay gelaufen sei. Ich schilderte ihm die Situation und er beruhigte mich, dass er mich als sehr motiviert erlebt hatte und man auf solche Aussagen nichts geben sollte. Schlussendlich schloss ich die Masterarbeit nach langem Kampf und Aushalten trotzdem mit einer sehr guten Note ab.
„Leider gibt es noch viel zu viele Gruppen, in denen vollständige Aufopferung verlangt wird.“
Heute promoviere ich seit einiger Zeit in einer anderen Gruppe und habe gelernt, dass die Atmosphäre und der Führungsstil des Gruppenleiters meiner Masterarbeit nicht (immer, aber leider noch viel zu häufig) die Norm sind. Zwar verlangt auch mein jetziger Chef von uns, dass wir nicht von einem 9 to 5 Job ausgehen und uns für unsere Doktorarbeit reinhängen, aber er versteht, dass wir auch nach der Arbeit ein Leben haben, Dinge auch mal schief gehen und wir nicht nur als Roboter im Kittel existieren. Er weiß, dass alle von uns einen Job in der Industrie anstreben und versteht, dass wir nicht bereit sind, alles aufzuopfern, so wie er es oft tut und wie es für eine Karriere in Academia oft notwendig ist. Leider gibt es noch viel zu viele Gruppen, in denen vollständige Aufopferung verlangt wird und jegliches Verhalten von Kollegen einfach hingenommen wird.
Ich bin froh, dass ich meinen Weg in eine andere Gruppe gefunden habe und mich nicht von den negativen Aussagen habe unterkriegen lassen. Auch jetzt plagen mich oft noch Zweifel, ob ich schlau/neugierig/motiviert genug bin, um die Promotion durchzuziehen, aber ich habe jetzt Kollegen um mich, die Freunde geworden sind und einen Chef, der uns und unsere persönlichen Wege unterstützt – gerade wegen meiner Erfahrung in der Masterarbeit weiß ich das noch viel mehr zu schätzen.
„Viele Doktorand:innen vermittelten mir den Eindruck, eine Last zu sein“
In meine Bachelorarbeit in der anorganischen Chemie bin ich hochmotiviert gestartet. Ich studierte in Regelstudienzeit, die Prüfungen im 5. Semester hatte ich mit sehr guten Noten bestanden, das Thema klang spannend, ich sollte coole neue Messmethoden kennenlernen – alles schien perfekt. Doch der erste Dämpfer kam schnell. Statt des spannenden Themas, auf das ich mich vorbereitet hatte, wurde mir ein Neues zugeteilt, mit dem ich wenig anfangen konnte. Mein Betreuer hatte bald kaum noch Zeit für mich, war tagelang nicht erreichbar, oft im Stress. An den Arbeitskreis fand ich keinen Anschluss. Stellte ich Fragen, war die Antwort oft „Das machen wir schon immer so“ oder „Wie kann man das denn nicht wissen?“. Aber woher sollte ich es als Bachelorandin, die Messmethoden gerade zum ersten Mal kennenlernt, denn wissen? Viele Doktorand:innen vermittelten mir den Eindruck, eine Last zu sein und dass sie wenig Interesse daran hatten, jüngeren Studierenden Wissen zu vermitteln und als Vorbilder zu fungieren. Ich arbeitete mehr und mehr allein, verbrachte viele überforderte Stunden im Labor, musste Messungen wiederholen, weil Messmethoden nicht gut erklärt wurden und verbrachte daher noch mehr Zeit im Labor. Gerne bin ich in der Zeit nicht zur Uni gegangen und ich fühlte mich schrecklich allein.
„Wie sollte ich den Anforderungen eines Masterstudiums gerecht werden, wenn ich zu blöd war, eine Bachelorarbeit zu schreiben?“
Am Ende der vier Monate war ich total erschöpft. Mein Kopf war leer. Ich hatte monatelang alles gegeben und fiel nun in ein tiefes Loch. Und als ich meine Note sah, fiel ich dann aus allen Wolken. Ich hatte so viel Zeit und Mühe investiert und war von allen meinen Kommiliton:innen die Schlechteste. Die Professoren waren nicht zufrieden, fanden hinten und vorne Fehler. Die restlichen Semesterferien konnte ich nicht mehr genießen. Meine Familie, die mir in der Zeit wunderbar zur Seite stand, musste viel Überzeugungsarbeit leisten, damit ich mein Masterstudium im Oktober überhaupt antrat. Denn wie sollte ich den Anforderungen eines Masterstudiums gerecht werden, wenn ich zu blöd war, eine Bachelorarbeit zu schreiben? Mein Selbstvertrauen war am Tiefpunkt. Vor Scham traute ich mich nicht, über meine Erfahrungen mit unserer Studiengangsmanagerin zu sprechen. Am liebsten wollte ich nie wieder über diese vier Monate reden!
Der Weg heraus aus diesem Loch war nicht einfach, doch das Masterstudium machte mir wieder Spaß. Ich setzte mir für das erste Semester kleine Ziele, die ich realistisch erreichen konnte: Ein Praktikum schaffe ich, das zweite ist Bonus. Ich schaffte dann gemeinsam mit meinen Freund:innen doch beide Praktika. Die Prüfungen verliefen gut und ich wurde allmählich wieder selbstbewusster. Als es Zeit wurde einen Arbeitskreis für die Masterarbeit auszuwählen, ging ich sorgfältiger vor als zwei Jahre zuvor für die Bachelorarbeit, informierte mich rechtzeitig über Themen und Anforderungen und erzählte meinem zukünftigen Betreuer ehrlich von meinen schlechten Erfahrungen und meinen Wünschen für die Masterarbeit. Ich hatte Glück, denn mein Betreuer war verständnisvoll und nahm sich in den sechs Monaten viel Zeit für mich. Der Arbeitskreis nahm mich freundlich auf. Ich merkte plötzlich, dass ich mit den richtigen Erklärungen und Hilfestellungen große Freude an wissenschaftlicher Arbeit entwickelte und spannende neue Ergebnisse selbstständig erarbeiten konnte - eine ganz neue Erfahrung, die mich beflügelte, das Thema in meiner Promotion weiterzuverfolgen. Damit hätte ich zwei Jahre vorher nie gerechnet! Es war toll zu sehen, dass Wissenschaft so viel Spaß machen und man für harte Arbeit auch belohnt werden kann.
„Es kann so erfüllend sein, Wissen an andere zu vermitteln“
Ich habe seitdem viel über mich und meine Arbeitsweise gelernt und hoffe, dass diejenigen von euch, die in ähnlichen Sinnkrisen und Tiefpunkten stecken, etwas mitnehmen können. Ihr müsst schlechte Betreuung nicht hinnehmen. Sprecht mit euren Betreuer:innen und klärt offen und ehrlich ab, was gut läuft, aber auch was in euren Augen verbesserungswürdig ist. Traut euch, euch Ansprechpartner:innen zu suchen. Und wenn euch ein Fach nicht liegt, sucht so lange weiter, bis ihr das für euch richtige gefunden habt, auch wenn es mehrere Anläufe braucht. Und als Doktorandin ist es für mich persönlich ein Privileg, jüngeren Studierenden Wissen zu vermitteln, aber nie eine Last. Ich bemühe mich seitdem, allen Praktikant:innen gegenüber eine gute und pflichtbewusste Betreuerin zu sein, damit möglichst wenige Studierende meine Erfahrungen während der Bachelorarbeit teilen müssen. Es kann so erfüllend sein, Wissen an andere zu vermitteln, gemeinsam zu lernen und zu wachsen! Erst so macht Chemie richtig Spaß!
„Chemiestudium mit den Noten? Na, wenn du meinst.“
Eigentlich fängt die Geschichte schon lange vor dem Abitur an. Der Vater ist Chemiker, der Bruder Überflieger in der Schule und dann ich, die in der 10. Klasse hinschmeißen und eine Ausbildung machen wollte, deren Noten mittelmäßig sind und die eher in Sprachen und Co. gute Noten hat, als in den Naturwissenschaften. "Das wäre verschwendetes Potential, die Ausbildung kannst du auch nach dem Abi noch machen". Ok, also weitermachen. Nachdem ich meinem direkten Umfeld mitgeteilt habe, dass ich Chemie studieren möchte, kamen aber Sätze wie "Chemie? Mach doch lieber was Kreatives, das ist doch viel mehr deins." oder "Du musst das nicht machen, um deinem Vater zu gefallen.". Nein, ich mache das, weil es für mich das einzig Interessante ist. Dann der Kommentar der Lehrerin meines Chemie-LKs bei der Zeugnisausgabe "Chemiestudium mit den Noten? Na, wenn du meinst." Aber zum Glück bin ich stur und fange das Studium dennoch an.
Zum Studium bin ich weggezogen und die ersten 3 Semester habe ich mindestens einmal die Woche unter Tränen zu Hause angerufen, weil ich nicht mehr konnte, überfordert war, ständig durch Klausuren durchgefallen bin und nicht wusste, wozu ich das überhaupt mache. Hatten die Leute alle Recht? Aber einen Plan B hatte ich nicht. Zum Glück bin ich stur, also weitermachen. 4. Bachelorsemester, endlich beginnen die Vorlesungen Sinn für mich zu ergeben, es macht Spaß mir Vorlesungen anzuhören, weil ich endlich die Zusammenhänge sehe. Ich weiß wieder, warum ich das machen wollte. Wäre da nur nicht diese eine Matheklausur im letzten Versuch. Habe ich schon erwähnt, dass ich Prüfungsangst habe, bei der ich regelmäßig Blackouts habe? Zack, durchgefallen. Exmatrikulation.
„Zum Glück bin ich stur, also weitermachen.“
Ein halbes Jahr lang auf der Suche nach einem Weg, das Studium doch noch irgendwie, irgendwo absolvieren zu können. Ein halbes Jahr lang so am Boden zerstört, dass ich mich an vielen Tagen nicht aus dem Haus traue, das auch gesundheitlich gar nicht schaffe. Zum Glück bin ich stur, also weitermachen. Dann endlich die Nachricht einer FH: Sie können bei uns nochmal von vorne mit dem Studium beginnen, gar kein Problem, direkt nächste Woche geht's los. Neuer Studienort, keine Freunde, das Gefühl, im ersten Anlauf komplett versagt zu haben und die Freunde aus der Uni sind inzwischen bei ihrer Bachelorarbeit angekommen - “Hallo Imposter-Syndrom!”. Aber dafür machen die Grundvorlesungen, die ich nun zum zweiten Mal höre, auf einmal Spaß. Ich sehe und verstehe endlich, wofür ich das alles brauche. Matheklausur? Gar kein Problem. Vielleicht gehöre ich doch hierhin und darf hier auch sein? Andererseits sagen viele, dass das eigentlich gar nicht rechtens sei, dass ich einfach so nochmal von vorne anfangen konnte in Deutschland, nach dem misslungenen Drittversuch in Mathe. Eine Angst, die einen bis in die Träume verfolgt.
Dann mündliche Prüfungen und Professor*innen, die einem an den Kopf werfen, dass das ja schon erstaunlich sei für jemanden wie mich (gemeint war stets mein Geschlecht), dass ich es überhaupt bis hierhin geschafft habe. Abwertende Kommentare zu Kleidung und Kosmetik kamen dazu, frei nach dem Motto "Jemand, der so viel pinkfarbene Kleidung, Lippenstift, Nagellack und Co. trägt, kann gar nicht gut in Chemie sein". Das hatte ich vorher nicht. Für die Bachelor-Arbeit dann ins Ausland für ein Thema, das nicht im Studium behandelt wird. Diese 6 Monate haben unfassbar viel Spaß gemacht! Von niemandem gab es Kommentare, dass ich nicht dorthin gehöre, viele waren positiv überrascht von meinem Wissen. Zurück in Deutschland beim Schreiben der Bachelorarbeit gab's dann aber wieder die Kommentare vom selben Professor "Das war ja klar, dass Sie das nicht verstehen. Wie Sie die 6 Monate dort überhaupt geschafft haben, ist unerklärlich." Zum Glück bin ich stur und inzwischen weiß ich (zumindest ein bisschen), dass ich gar nicht so fehl am Platz bin.
Für den Master dann wieder Studienortwechsel - zurück an eine Universität. Vorher aber noch ein Bewerbungsgespräch dort absolvieren. So nervös war ich schon lange nicht mehr. Was ist, wenn die Gesprächspartner auch der Meinung sind, ich gehöre hier nicht hin? Was ist, wenn die Matheklausur von damals doch noch ein Problem ist? Und tatsächlich kam schnell das Thema des Studienortwechsels und der Grund für den Neubeginn auf. Am liebsten wäre ich im Boden versunken, schreiend rausgerannt und hätte aufgegeben. Stattdessen saß ich da und habe versucht, das Ganze zu erklären. Die Antwort war überraschend: "Respekt, dass Sie trotz allem weitergemacht haben und nun hier sitzen, das zeigt Ihr Durchhaltevermögen. Wir glauben, Sie wären hier gut aufgehoben und würden Sie gerne für den Master hier haben." Das hat mir die Sprache verschlagen. Die Erleichterung war riesig. Endlich hat mal ein Professor mir gesagt, dass ich dazugehöre.
Im Master dann auch mehrere Klausuren, die im ersten Anlauf scheitern. Ok, das gehört inzwischen dazu. Aber keine erscheint mehr hoffnungslos. Ich habe dann bei der Suche nach einem Thema für die Masterarbeit eine Stelle gefunden, die wie für mich gemacht erscheint. Ähnliches Thema wie in der Bachelorarbeit, nur weiter ausgebaut. Das kann nur gut werden! 5 Wochen nach Beginn der Masterarbeit reiche ich die Kündigung ein. Das waren 5 Wochen zu viel Demütigung und Erniedrigung. 5 Wochen voller Bauchschmerzen, 5 Wochen, in denen ich fast täglich Sätze wie im Bachelor zu hören bekommen habe. "Sie haben keine Ahnung, aber was soll man von jemandem wie Ihnen auch erwarten?" Beim Abschlussgespräch dann noch Sätze wie: "Dass Sie es überhaupt bis hierhin geschafft haben ist unbegreiflich, den Masterabschluss schaffen Sie sowieso nicht, vielleicht sollten Sie sich etwas anderes suchen." Zum Glück lasse ich das nicht mehr mit mir machen.
„Ich werde hier weitermachen, auch wenn ich vielleicht nicht die Beste sein werde.“
Nach ein paar Monaten hatte ich dann ein neues Thema, bei einem anderen Professor einer anderen Gruppe. Zwar in einem ganz anderen Themengebiet als mein ursprünglich angepeiltes, aber dennoch wie gemacht für mich. Die Masterarbeit habe ich dann auch geschafft und inzwischen bin ich Doktorandin in dieser Gruppe. Oft genug frage ich mich zwar noch immer, ob ich wirklich hierher gehöre und ob ich die Promotion lieber lassen sollte, aber inzwischen weiß ich auch, dass es vielen so geht und dass es für mich der einzige richtige Weg ist. Es gäbe aber auch noch immer keinen Alternativplan. Zum Glück bin ich stur. Ich werde hier weitermachen, auch wenn ich vielleicht nicht die Beste sein werde. Und ich werde weiterhin die Farbe Pink lieben, die Chemie bekommt ihr nicht aus mir raus.
„Doch das Studium musste natürlich weitergehen, da ich mir von „sowas“ nicht die Regelstudienzeit ruinieren lassen wollte.“
Ich war bereits im 3. Semester des Chemiestudiums und im 2. Corona-Semester. Soweit habe ich mich gut arrangieren können, die Vorlesungen von zuhause zu machen. Nur die Treffen mit Freunden und das richtige Kennenlernen der anderen Studierenden blieben aus. Mit dem Gedanken, dass es bald besser wird, hat mich das nicht weiter gestört. Das Studium war selbstverständlich nicht einfach und hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen, aber gefühlt hat man sich daran gewöhnt. Doch im Februar 2021 während der Vorbereitung auf Klausuren und Praktika habe ich plötzlich einige körperliche Beeinträchtigungen wie Schwindel, Zittern, Nervosität und Atemprobleme bemerkt. Der Auslöser hatte nicht direkt etwas mit der Uni zu tun, aber die Dauerbelastung von Lernen und Corona haben die Situation nicht erleichtert.
Über einen Zeitraum von 1-1.5 Jahren wurden immer wieder ärztliche Untersuchungen durchgeführt und ich habe verschiedene Fachleute besucht. So ging es von Kardiologie über Neurologie zu Radiologie und so weiter. Gerade das erste halbe Jahr wurde von unzähligen (milden) Panikattacken am Abend oder in der Nacht begleitet. Ständig auftretende Atemnot und Schwindel gehörten damals leider zum Tagesprogramm und treten vereinzelt auch heute noch auf. Damals hat mich nur der Gedanke daran, alleine in der Wohnung zu sein, so nervös gemacht, dass ich die meiste Zeit währenddessen geschlafen habe, um das Alleinsein nicht mitzubekommen. Doch das Studium musste natürlich weitergehen, auch wenn es nicht immer funktioniert hat, da ich mir von „sowas“ nicht die Regelstudienzeit ruinieren lassen wollte.
„Es schien so, als ob niemand anderes solche Probleme hatte.“
Ist man selbst nicht immer im guten bis sehr guten Notenbereich, vergleicht man sich schnell mit Anderen und bekommt das Gefühl, eventuell nicht das Richtige zu studieren oder nicht schlau genug dafür zu sein, obwohl es einem Spaß macht. Gerade durch die Distanz während der Corona-Semester wurde es schwierig, regelmäßigen Kontakt mit Kommilitonen zu halten. Gesehen hat man sich schließlich nur im Praktikum (das glücklicherweise stattfand) oder bei Klausuren. Ich habe den Eindruck gehabt, dass man dadurch solche Themen nicht unbedingt angesprochen hat, falls sie einen beschäftigen. Es schien so, als ob niemand anderes solche Probleme hatte.
Nach einiger Zeit habe ich mich darum gekümmert, mir einen Therapieplatz zu suchen. Meine Freunde haben mir unfassbar viel Gehör gespendet, zugehört und mir eine Therapie empfohlen. Zunächst habe ich mich an den Allgemeinen Studierendenausschuss gewendet, der mir eine Adresse zum Suchen von Psychotherapeut:innen empfohlen hat, da auch die Beratungsprogramme der Universität schon längere Wartelisten hatten. Daraufhin habe ich bei einer Praxis ein paar Erstgespräche gehabt und nach einem halben Jahr, das mit ein paar weiteren Gesprächen überbrückt wurde, insgesamt 24 Sitzungen in Anspruch genommen. Ziel war, an der diagnostizierten Angststörung zu arbeiten, die bis heute der Auslöser meiner gesundheitlichen Beschwerden ist. Meine Therapeutin und ich sind zu dem Schluss gekommen, dass das Studium ein treibender Faktor für die anhaltenden Symptome ist. Mithilfe der Therapie habe ich glücklicherweise einen Großteil meiner damals akuten Probleme ablegen und den Umgang damit lernen können.
„Aber warum sollte man nur die Symptome von Dauerstress bekämpfen?“
Nach und nach wurde mir bewusst, dass es eigentlich nicht normal ist oder sein sollte, jedes Wochenende durchgehend zu lernen und wichtige Lebensjahre, in denen sich viele selbst finden, ausschließlich damit zu füllen. Dennoch bekommt man im universitären Umfeld der Naturwissenschaften schnell den Eindruck (wenn auch nicht immer absichtlich), dies sei der Normalzustand und das hätte jede:r durchgemacht.
Spricht man mit Doktorand:innen oder Student:innen höherer Semester, bekommt man oft gesagt, dass es nur noch anstrengender wird. Ich frage mich, warum das Aufopfern der mentalen Gesundheit während des Studiums als Standard angesehen wird, obwohl in vielen Bereichen heutzutage über eine bessere Work-Life-Balance diskutiert wird, da man ja auch Zeit für sein Privatleben haben möchte. Im naturwissenschaftlichen Bereich allerdings „muss man da durch“ und „so ist das halt“. Solche Aussagen erinnern mich immer an das typische „das haben wir schon immer so gemacht“, eine Aussage, die keinesfalls mehr zeitgemäß ist. Natürlich werden von den Universitäten Angebote für psychologische Beratung bereitgestellt, aber warum sollte man nur die Symptome von Dauerstress bekämpfen und nicht mal der Ursache auf den Grund gehen? Es fangen schließlich auch immer weniger Leute an Chemie zu studieren, die Erfahrungen von Absolvent:innen, sprich: keine Freizeit, durchgehend lernen und Protokolle schreiben, sind da wohl nicht sehr hilfreich, mehr Leute für den Studiengang zu begeistern.
Natürlich handelt es sich bei Chemie nicht um ein einfaches Studium, das man mal so macht. Aber die Leute, die sich dafür interessieren, sollten nicht unter dem Leistungsdruck leiden und später wird gefragt, warum es immer weniger Absolvent:innen oder sogar Anfänger:innen gibt. Solche systematischen Probleme lassen sich nicht von heute auf morgen beheben, aber das Studium sollte präventiver mit solchen Thematiken umgehen, anstatt nur die auftretenden Probleme zu behandeln.
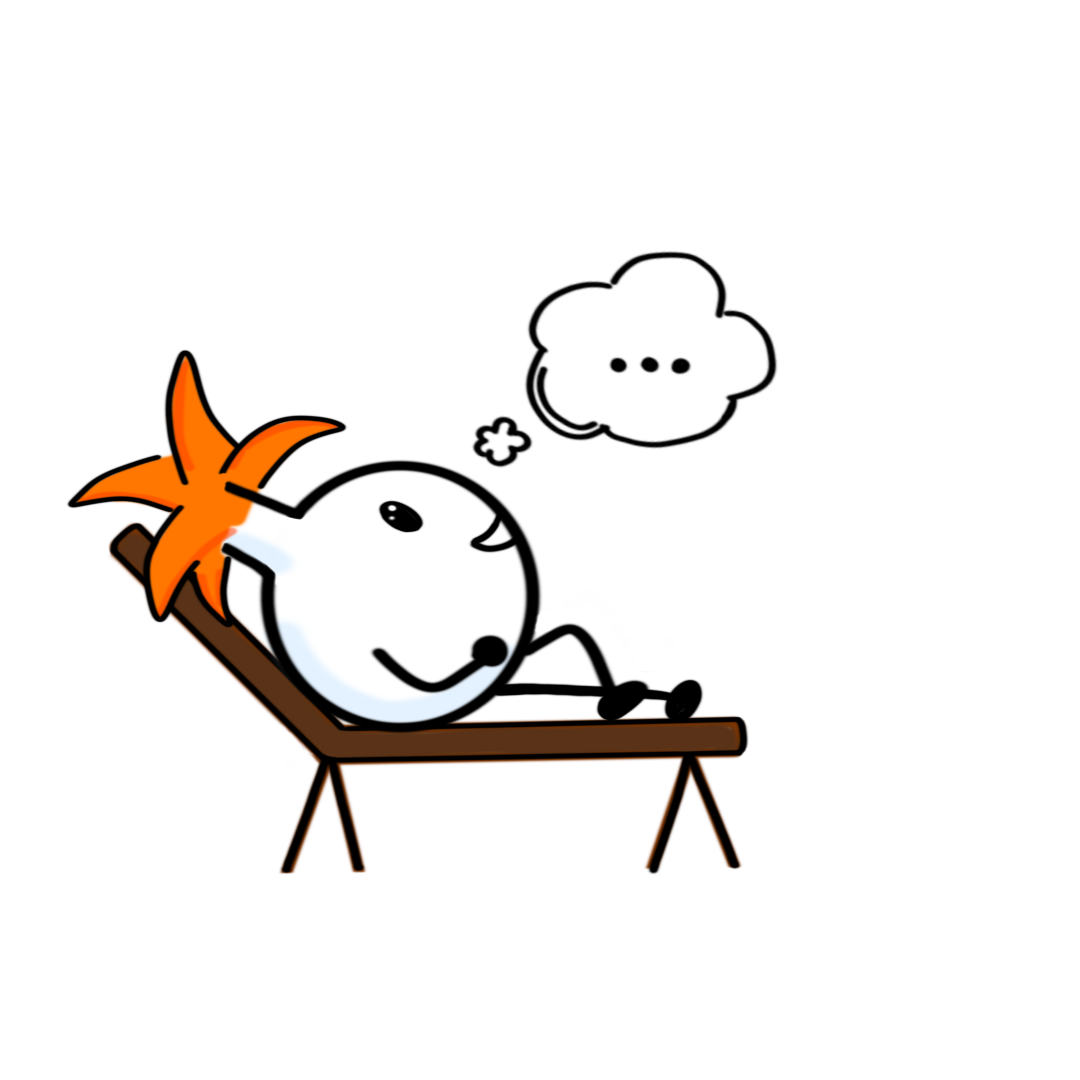
„Ich habe mir eingeredet, ich müsse einfach noch mehr lernen.“
Ich bin fast fertig mit meinem Studium, doch bevor ich an diesen Punkt gelangen konnte, musste ich vieles über mich selbst lernen. Zu Beginn meines Studiums entwickelte ich starke Prüfungsangst. Mir fiel es schon zwei Wochen vor der eigentlichen Klausur schwer, normal zu schlafen oder zu essen und ich lernte stundenlang ohne Pause. Auch wenn ich den Stoff drauf hatte und in der Lerngruppe merkte, dass ich sehr viel konnte und gut vorbereitet war, war mein Kopf in der Klausur wie leergefegt.
Ich konnte mich an nichts mehr erinnern und saß nervös auf meinem Sitzplatz. Ich versuchte noch, irgendetwas auf das Blatt zu bekommen, an das ich mich erinnern konnte. Die Angst zu versagen, im Drittversuch zu landen, vor allem in eine neue Stadt gezogen zu sein, um dann zu scheitern, war riesengroß. Doch das Verrückteste war, dass ich das alles gar nicht so wahrnahm, bis ich mich aktiv mit meinem Problem auseinandergesetzt habe.
Bis zum dritten Semester habe ich mir eingeredet, ich müsse einfach noch mehr lernen und härter arbeiten, dann würde ich die Klausuren auch bestehen. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich viele Klausuren zweimal schreiben müssen, doch diesmal sollte ich gleich in drei Drittversuchen landen. Wie konnte das sein, wo ich mich doch so sehr für Chemie interessiere, fleißig lerne und ich mir sicher bin, dass ich dieses Studium abschließen möchte? Erst viel zu spät habe ich realisiert, dass ich womöglich Prüfungsangst und dadurch Blackouts in der Klausur hatte und das nicht einfach nur Unwissenheit meinerseits war. Ich suchte mir also Hilfe bei der psychosozialen Beratungsstelle der Uni, nahm mich ein Semester stärker von der Uni zurück und arbeitete stattdessen an mir selbst. Ich hatte damals eine peer-to-peer Beratung und besuchte diese jede Woche ein halbes Jahr lang. Ich wusste, wenn ich dies nicht in den Griff bekommen würde, würde ich die Drittklausuren nicht packen.
„Das soll jetzt die Lösung meiner Probleme sein? Atemübungen?“
Die ersten Sitzungen saß ich in einem Stuhl und wir probierten verschiedene Atemübungen aus. Durch meinen Kopf ging nur... das soll jetzt die Lösung meiner Probleme sein? Atemübungen? Doch ich lernte noch viel mehr. Ich lernte mich selbst kennen, wie ich meine Nervosität und Angst kontrollieren kann. Und tatsächlich, ich bestand alle Drittversuche, sogar zum Teil sehr gut und bin seitdem nie wieder in meinem Studium durch eine Prüfung gefallen.
Es ist immer noch eine Angst, die mich bei Prüfungen begleitet hat und weiterhin begleitet, dennoch weiß ich nun damit umzugehen. Und ich weiß auch, hätte ich mir damals keine Hilfe gesucht, hätte ich mein Traumstudium Chemie nicht weitermachen können. Die Moral von der Geschichte: Wenn du merkst, dass etwas nicht stimmt, höre genauer auf dich selbst und hol dir schnellstmöglich Hilfe! Es gibt viele tolle Angebote und es wird dir geholfen! Du musst dich nur trauen.

„Vorurteile findet man überall. Mikroaggressionen sind Teil des täglichen Lebens.“
Offen schwul sein ist für mich kein Problem mehr. OK das ist eine Lüge. Mittlerweile trenne ich Arbeit und Privates. Aber als ich mit dem Chemiestudium begann, habe ich mich relativ schnell geoutet. Nicht weil ich es wollte. Eher weil ich wusste, dass ich nicht wieder versteckt leben möchte. Ganz (unter)bewusst habe ich diesen kleinen bzw. großen Fakt aber oft unterschlagen. Und zwar immer dann, wenn ich der Meinung war, dass eine Station meines Lebens karriereentscheidend sein könne. Relativ traurig das zuzugeben. Aber ich lebe schon lange in der Realität und mache mir nichts vor. Vorurteile findet man überall. Mikroaggressionen sind Teil des täglichen Lebens. Und seien wir mal ehrlich! Wenn man an Chemiker denkt, ist homosexuell das Letzte, was man damit in Verbindung setzt. Unser Stereotyp ist schrill bunt, etwas neben der Spur, macht etwas Kreatives und ist eventuell sogar HIV+. Kaputte Jeans, dunkles T-Shirt und eine Vorliebe für Naturwissenschaften und Star Trek entsprechen nicht diesem Bild. Aber das ist nicht die Geschichte, die ich erzählen möchte.
Während meiner Masterarbeit kam es nun zu einer Situation, die ich kurz als potentiell problematisch empfand. Mein Betreuer war aus dem Nahen Osten genauso wie sein Betreuer auch. Ich kenne keinen Witz der mit „ein Schwuler, ein Ägypter und ein Syrer gingen in eine Bar“ beginnt. Aber tatsächlich haben wir uns entgegen meiner Vorurteile bzw. Ängste bestens vertragen und gingen tatsächlich oft nach der Arbeit in Bars. Eine richtige Saufrunde wurden wir und ich erinnere mich immer noch gerne an diese Zeiten. Kein Grund sich nicht zu Outen.
Eines Tages standen wir während der Arbeit mit einer befreundeten Doktorandin vor der Tür. Der Betreuer von meinem Betreuer erzählte davon, dass er am überlegen sei, sich für seinen nächsten Vortrag eine pinke Krawatte zu kaufen. Nicht weil er pink so sehr mochte. Nein, vielmehr weil unser Professor sehr oft pinke Krawatten trug und ihm das sehr gefiel. Daraufhin wurde er scharf von der Doktorandin attackiert. Mein Betreuer fing an ihn zu verteidigen und meinte, dass auch er einen Gefallen an pinken Krawatten gefunden habe und selbst am überlegen sei, eine bei seiner wissenschaftlichen Aussprache zu tragen. Er wurde mit den Worten überfahren, wenn er so etwas täte, dann sei er kein richtiger Mann und niemals würde eine normale Frau jemals mehr mit ihm schlafen wollen.
„Du bist ja auch kein richtiger Mann. Du bist schwul.“
Ich stand etwas benommen daneben und meinte dann mit ruhiger Stimme, dass ich mir einen leicht rosa Pullover bestellt habe. Die Doktorandin drehte sich rasend schnell zu mir um. Ihr bitterer Blick wurde plötzlich ganz weich. Den Kopf legte sie in leichte Schieflage. Und dann sagte sie: „Du kannst das tragen. Du bist ja auch kein richtiger Mann. Du bist schwul. Du willst eh keinen Sex mit Frauen. Aber eine richtige Frau würde nie mit einem Mann schlafen, der pinke Sachen trägt“. Sie drehte sich um und ging.

„Ich fiel in ein Loch, konnte mich kaum konzentrieren.“
Meine Depressionen begleiten mich schon eine ganze Weile, und ich habe sowohl während des Bachelor- als auch Masterstudiums diverse Medikamente und Therapien genutzt. Während dieser Zeit empfand ich meine Krankheit immer als beschämend. Es wussten nur sehr wenige Freunde darüber Bescheid. Für Therapiesitzungen ließ ich mir gerne Lügen einfallen, um mein Verbleiben anders zu erklären. Eine Depression. Es hatte immer etwas von „Mit mir stimmt etwas nicht“ an sich, weswegen ich nicht darüber reden wollte und meine Krankheit versteckte.
Nach meinem Masterstudium hatte ich bereits eine Zusage für eine Promotionsstelle für die Arbeitsgruppe, in der ich auch Masterarbeit geschrieben habe. Obwohl ich diese verkackt habe – ich habe einfach irgendwann aufgegeben – sah der Professor weiterhin mein Potential. Zu der Zeit war ich jedoch wieder so tief in einer depressiven Episode, dass ich diese Promotion nicht anfangen wollte. Stattdessen habe ich mir eine Auszeit gegönnt, und zwar weg von der Chemie.
Doch irgendwann kribbelte es in den Fingern. Mir fehlten das Labor und die Wissenschaft. Auch wenn ich vorher gezweifelt habe, ob Chemie das richtige für mich sei, so kam jetzt die Gewissheit. Ich fand eine Stelle – zunächst als Mutterschaftsvertretung, und wurde anschließend in meinem Können bestätigt, als dass mir eine Promotionsstelle angeboten wurde. Es lief einige Zeit gut, bis sich meine Depression wieder meldete.
Ich fiel in ein Loch, konnte mich kaum konzentrieren, geschweige denn den Workload einer Promotionsstudentin leisten. Ich suchte wieder Kontakt zu meinem Psychiater, meiner Therapeutin, aber dieses Mal auch zu der Beratungsstelle der Universität. Mittlerweile war die Corona-Pandemie dazugekommen, welche die Situation nicht gerade erleichterte. Nach mehreren Gesprächen mit all diesen Personen, habe ich zwei wichtige Entscheidungen getroffen, vor denen ich mich immer gefürchtet hatte. Zum einen habe ich mich für eine stationäre Therapie in einer Klinik entschlossen. Zum anderen dafür, meinem Professor meine Situation zu erklären. Dabei war die Vorstellung im Vorfeld „Was könnte er im schlimmsten Fall sagen?“ sehr hilfreich.
„Die Gesundheit steht an erster Stelle.“
Ich schrieb meinem Professor eine E-Mail und bekam sehr viele liebe, hilfreiche und verständnisvolle Worte zurück. Zum einen, dass er auch eine Kollegin kennt, die mit diesem Problemen zu kämpfen hat, zum anderen aber auch, dass er über die Offenheit sehr froh ist und seine Hilfe anbot. Auch als ich nach ein paar Monaten Wartezeit den Therapieplatz in der Klinik bekam und innerhalb von einem Tag anreisen sollte, war dieses kein Problem, vielmehr wurde ich unterstützt. Im Nachhinein sind diese Wochen der Therapie ein Meilenstein meines Umgangs mit dieser Krankheit und seitdem geht es mir deutlich besser.
Noch immer gibt es Momente, in denen es mir nicht gut geht. Es ist ein langer Weg diese zu akzeptieren. Jedoch macht es diese Arbeit und Akzeptanz deutlich einfacher, indem ich meinem Professor offen sagen kann, wie es mir geht. Oft setzen wir uns dann zusammen und beraten, wie es am einfachsten für mich wäre. Auch zu sagen, dass ich wegen Therapiesitzungen früher gehen muss, ist von ihm akzeptiert. Die Gesundheit steht an erster Stelle.

Langsam kriechen die Zweifel wieder in mir hoch. Hab ich denn eine Chance? Lohnt es sich überhaupt, wenn ich eh nicht so gut sein werde wie meine Freunde? Naja, irgendwen mit schlechteren Noten muss es ja geben, damit andere bessere haben. Aber ist das mein Weg? Immer maximal mittelmäßig? Lern weiter, das bringt nix. Ein Gedanke versteckt sich immer zögerlich hinter einer Tür im Kopf, lugt um die Ecke. Jedes Mal kommt er ein wenig weiter hervor: Vielleicht bin ich einfach nicht intelligent genug für dieses Studium. Ganz rational betrachtet. Ganz faktisch. Und selbst wenn ich weiterkomme, wird immer auf mich runter geschaut. Die ist halt auch hier. Muss man halt immer mittragen, braucht halt ewig. Als Lehrerkind kenne ich die andere Seite, glaube ich. Schlechte Schüler werden halt mitgezogen. Aber das hier habe ich mir ausgesucht. Wie ein Dozent es leicht süffisant formuliert: „Dann sollte man sich nochmal überlegen, ob das für einen der richtige Weg ist." Er ist bekannt dafür, sich nur die guten Leute für seinen Chef und dessen Arbeitskreis rauszusuchen. Der Zug ist für mich schon abgefahren. Vielleicht bin ich einfach nicht intelligent genug für die Wissenschaft. Wenn man alle Gefühle von Frust und Lerndemotivation wegnimmt, ist das doch der Kern.
Immer im Verzug. Immer eine Klausur mehr, nochmal schreiben, noch ein Protokoll abgeben. Aus einer Menge Angst heraus lerne ich viel auf Kurzzeitgedächtnis. In der Klausur reicht das gerade so und rächt sich dann ein Semester später wieder. Meine neuen Freunde: eine starke (Lern-)gruppe. Ein paar können das alles mit geringem Aufwand, ein paar arbeiten genauso hart wie ich, sind aber bei gleicher Lernmenge immer eine ganze Note besser als ich. Schwer zu greifen, schwer auszuhalten.
„Bin ich einfach nicht intelligent genug für die Wissenschaft?“
Immer wieder geht mir durch den Kopf, dass es doch eine Beratungsstelle an der Uni gibt. Es dauert lange, bis ich mich tatsächlich traue einen Termin zu machen. Das erste Gespräch ist wie eine Anamnese. Eine schwierige Situation, aber befreiend. Da nimmt sich jemand eine ganze Stunde Zeit für mich. Beim zweiten Gespräche in der Beratungsstelle beschreibe ich die Überforderungsgefühle. Herr M* von der Beratungsstelle lässt mich aufzählen, was ich letztes Semester gemacht habe. 9 Klausuren. Zwei Laborpraktika, semesterbegleitend, und im Anschluss wie immer mit Protokollen. Das haben alle anderen ja auch gemacht, wende ich ein. Und es sind auch nur so viele Klausuren, weil ich zwei wiederholen musste. Selber Schuld, ein Teufelskreis. Er bringt mir bei, dass das deutlich mehr ist, als viele der anderen Studiengänge für zwei Semester auf dem Plan haben. Er schlägt mir eine andere Sichtweise vor: Wir alle sind Fische, die in einem riesigen Kreis schwimmen. Manche schneller, manche langsamer, manche weiter oben, weiter unten, weiter innen, weiter außen.
Aber wir schwimmen alle im Kreis, es gibt keine Start- und keine Ziellinie. Jeder schwimmt einfach. Wir wechseln die Bahnen an den unterschiedlichsten Stellen im Leben. Und das kommende Labor werde ich auch schon schaffen, erstmal gucken was kommt. Mit einem leicht besseren Gefühl verlasse ich das Gespräch, aber ganz überzeugt bin ich nicht. Es hilft, dass er den Umfang des Studiums kennt. Aber am Ende wird doch spätestens zur Bachelorarbeit allen klar, dass ich hier eigentlich nichts zu suchen habe. Bisher habe ich im Studium nur bewiesen, dass ich nicht gut bin. Meine Stärken liegen wohl woanders. Aber ich will das hier doch? Farbumschläge im Labor begeistern mich, ich koche gerne, im Labor und Zuhause. Praktisches Labor ist das, wovon ich begeistert erzähle. Reicht das? Sicher nicht.
Ich gehe zu einigen Beratungsgesprächen, überstehe das OC-Praktikum und die nächste Klausurenphase steht an. Ich habe etwas mehr Selbstwert, er ist vielleicht nicht nur von einer Note abhängig. Die Freundschaft zu den Lerngruppenfreunden ist gewachsen, wir lernen intensiv zusammen, helfen uns, lachen. In die Klausuren gehe ich fast so gestresst wie vorher, aber da hat sich auch etwas „so what" mit eingeschlichen. Vier Wochen später bin ich schon im nächsten AC-Praktikum, dieses ist tatsächlich mal entspannter und auch interessanter. Die Dozentin, die uns betreut, spricht mich an. Ob ich die Bachelorarbeit bei ihr machen möchte, ich sei ihr positiv im Labor aufgefallen. Begeistert, aufmerksam, menschlich. Selten bin ich so rot geworden. Irgendwas hatte ich richtig gemacht. Ich mache meine Bachelorarbeit bei ihr, schaffe den Übergang in den Master.
Weitergemacht, immer wieder gekämpft, aber weitergemacht. Die Prüfungsangst wird nur ein wenig besser, aber meine Erfolgserlebnisse lassen sich nicht ganz ignorieren, der Master läuft irgendwie. Auslandssemester. Masterarbeit. Dann finde ich eine zu mir passende PhD-Stelle an einer neuen Uni. Vom reinen „Kopf-über-Wasser-halten" zum lange unerreichbaren Ziel: Ich bin Doktorandin der Chemie. Das bringt seinen eigenen Stress mit, klar. Mich begleiten weiterhin Perfektionismus und ab und zu dieser nagende Gedanke, ob mich der Prof nicht doch einfach nur brauchte und erst demnächst feststellen wird, dass ich eigentlich gar nicht geeignet bin. Das sind weiter Baustellen. Aber ich bin Doktorandin. Und das ist verdammt cool.
Bis heute danke ich der Einsicht und den Denkanstupsern von Herrn M. Er hat seinen Kopf in meinen Teufelskreis gesteckt und mir einen Halt gegeben, von dem aus ich weitermachen konnte. Ganz wichtig war für mich: Er kannte mich vorher nicht. Ihm habe ich durch den Abstand einen objektiven Blick zugetraut, gerade auch, weil er von den Anforderungen des Studiums wusste. Er wusste „dann lass halt mal eine Klausur aus" war keine Option, ohne das Studium wieder um eine Jahr zu verlängern.
Das alles war keine Heilung von heute auf morgen, sondern ein stetiger und teilweise noch anhaltender Prozess. Schritt für Schritt. Und das ist in Ordnung.
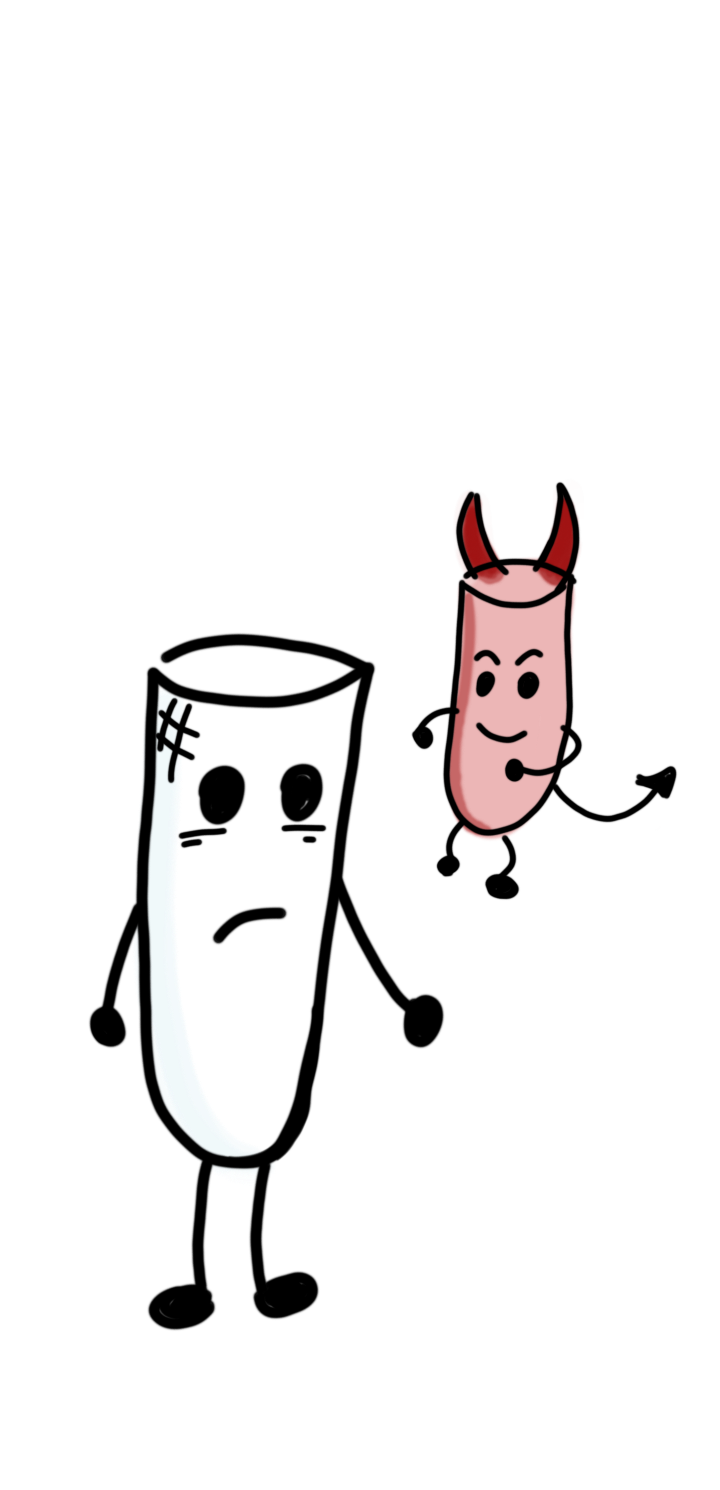
„Vielleicht soll es einfach nicht sein.“
Im Masterstudium können wir eins der Fachpraktika im Ausland absolvieren und schon im Bachelor wusste ich, wo es hingehen sollte. Aufgrund der Pandemie war mein Plan für September 2020 jedoch erstmal hinfällig geworden und ich habe beschlossen, erst alle anderen Praktika und die Masterarbeit zu machen, denn bis Herbst 2021 ist die Pandemie ja bestimmt sowieso vorbei - (hatte ich gedacht).
Nachdem auch einige Laborpraktika an meiner Uni wegen Corona verschoben werden mussten, habe ich im Dezember 2021, bereits im 5. Mastersemester, meine Masterarbeit abgegeben. Jetzt fehlten mir nur noch die Punkte für 12 Wochen Auslandspraktikum. Am 2. Januar sollte es losgehen und bis Ende November sah es auch gut aus - ich hatte ein Zimmer auf dem Campus, den Flug gebucht, eine Krankenversicherung abgeschlossen, nur noch Visum beantragen und dann geht es los! Aber dann kam Omikron und die Grenzen wurden wieder geschlossen. Im Januar wurden sie zwar wieder geöffnet, aber das Visiting Student Programme des Instituts wurde aufgrund hoher Inzidenz gestoppt.
Es war ein einziges hin und her, immer mal ein Funke Hoffnung, dass ich bald einreisen könnte, dann doch wieder nicht. Statt zwei Wochen über Weihnachten, war ich also fast drei Monate bei meinen Eltern, denn aus meiner Studienstadt war ich im Dezember trotzdem ausgezogen, im Glauben meine Ankunft würde sich nur wenige Wochen verzögern. In der Zeit haben viele Freunde und Verwandte immer wieder gefragt „Weißt du schon wie und wann es weitergeht?”, „Was ist dein Plan B?”, „Wie lange willst du noch warten?”, „Meinst du nicht, es ist besser, dann was anderes zu machen?” „Vielleicht soll es einfach nicht sein” „Dann werden es ja jetzt sicherlich 6 Semester”...
Klar, prinzipiell ist es keine schlechte Idee einen Plan B zu haben und ich habe mich all das definitiv auch gefragt. Durch das Chemie-Studium ist man es gewöhnt, dass es immer etwas zu tun und zu lernen gibt. Im ganzen Studium hatte ich nie länger als zwei Wochen frei und auch da immer eine Klausur im Hinterkopf. Aber mich jetzt woanders zu bewerben, würde sicherlich genauso lange dauern, wieeinfach noch ein paar Wochen zu warten. Außerdem hatte ich mich auf ein Stipendium beworben, was ich für speziell dieses Praktikum bekommen sollte. Jetzt in ein anderes Land zu gehen, würde bedeuten das Stipendium zu verlieren.
Und vor allem: Ich hatte es mir viel zu lange, viel zu fest in den Kopf gesetzt, als dass ich jetzt sagen könnte, ich mache etwas anderes. Und die Anzahl der Semester sind besonders jetzt nach der Pandemie sicherlich noch weniger relevant. Ich habe den Bachelor in Regelstudienzeit gemacht und falls es wirklich jemanden interessieren sollte, kann ich sehr gut erklären, warum ich für den Master so lange gebraucht habe.
Letztendlich war es eine super schöne Zeit Zuhause. Ich habe die letzten fünf Jahre während des Studiums eher selten entspannte Zeit mit meiner Familie verbringen können und Anfang Januar wäre wirklich etwas stressig gewesen, so kurz nach der Masterarbeitsabgabe und dem Umzug.
So war ich erholt und absolut bereit für Neues. Und das Warten hat sich mehr als gelohnt! Die Zeit im Ausland ist wirklich fantastisch. Ich bin in einer super netten Arbeitsgruppe mit einem entspannten Prof und konnte schon viel von Land und Leuten kennenlernen. Mir ist bewusst, dass es nicht immer und für jeden möglich ist, finanziell oder aus familiären Gründen, so eine Pause einzulegen. Aber es hat mir definitiv gezeigt, dass es prinzipiell sehr positiv sein kann, auch mal absolut nichts zu tun, sich zu erholen und sich auch mental auf einen neuen Abschnitt vorzubereiten. Und dass man sich nicht zu sehr vom Umfeld stressen lassen und mit anderen vergleichen sollte.

„Ich habe meine Promotionsstelle gewechselt und es war die beste Entscheidung meines Lebens.“
Schon während meiner Masterarbeit wurde ich von vielen Festangestellten angesprochen, ob ich nicht in der Arbeitsgruppe bleiben und promovieren möchte. Kurz daraufhin habe ich mit meinem Professor mein Promotionsthema besprochen – ich war direkt Feuer und Flamme. Schon nach kurzer Zeit hatte ich vier weitere Projekte, an denen ich arbeiten sollte. Mein einziger Feind war die Zeit. So dachte ich. Wie falsch ich damit lag, wurde mir erst im Nachhinein bewusst. Ich kannte keine Wochenenden mehr und war gefühlt nur noch im Labor. Wochen mit mehr als 70 Stunden waren zur Normalität geworden und das bei einer 50%-Stelle. Als der Winter am dunkelsten war, wurde ich krank. Ich bekam die schlimmste Grippe meines Lebens. Obwohl ich für einige Wochen krankgeschrieben war, schleppte ich mich krank zurück ins Labor.
Es dauerte nur wenige Stunden bis ich einen Anruf bekam. Plötzlich saß ich meinem Professor und seiner rechten Hand gegenüber. Nach einigen einleitenden Worten meines Professors und dem netten Hinweis, dass die dritte Person nur als „stiller Beobachter“ anwesend sei, begann meine Reise durch die Hölle mit seinen Worten: „Auf der Welt gibt es Manager. Die fliegen von Stadt zu Stadt und von Land zu Land. Jeder Job verlangt bestimmte Fähigkeiten von einem Menschen. Auch eine Promotion verlangt sehr viel. Ich glaube nicht, dass Sie krank sind. Sie halten den Stress nicht aus. Ob heute oder morgen ist mir egal, aber in den nächsten Tagen sollten Sie sich überlegen, ob eine Promotion für Sie das Richtige ist.“
Alle Versuche mich und meine Erkrankung zu erklären, wurden unterdrückt und ich wurde gebeten zu gehen. Unter Schock stand ich noch einige Minuten regungslos vor dem Aufzug. Die nächsten Wochen und Monate wurden zur Qual. Ich bekam willkürlich Kontrollanrufe meines Professors. Ich durfte keine E-Mail mehr schreiben, ohne ihn ins CC zu setzen. Zu jeder Tageszeit musste ich zur Verfügung stehen. Oft kamen E-Mails mit Deadlines zum nächsten Tag nach 18 Uhr. Um es mit seinen Worten zu sagen: „Die Wissenschaft schläft nie.“ Nach wenigen Wochen wurde ich plötzlich von meinem Prof. zur Personal- und Rechtsabteilung geladen. Mit Unterstützung der Sozialberatung und des Personalrats konnte ich alle Anschuldigungen entkräften.
Dem mir angebotenen Aufhebungsvertrag habe ich nicht zugestimmt. Meine Welt lag in Scherben. Wenige Tage später, als ich gerade ein Praktikum betreute, bekam ich eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Ich hatte mich auf genau eine Stelle beworben. Emotional war ich zu mehr nicht im Stande gewesen. Und nicht einmal zwei Monate nach dem Gespräch mit der Personalabteilung hatte ich eine neue Stelle. Aber dieses Mal nicht an der Universität sondern an einem Forschungsinstitut. Es war die einzig richtige Entscheidung zu gehen. Ich hatte große Befürchtungen, dass sich ein Wechsel der Promotionsstelle negativ auswirken könnte. Aber das tat und tut es bis heute nicht.



